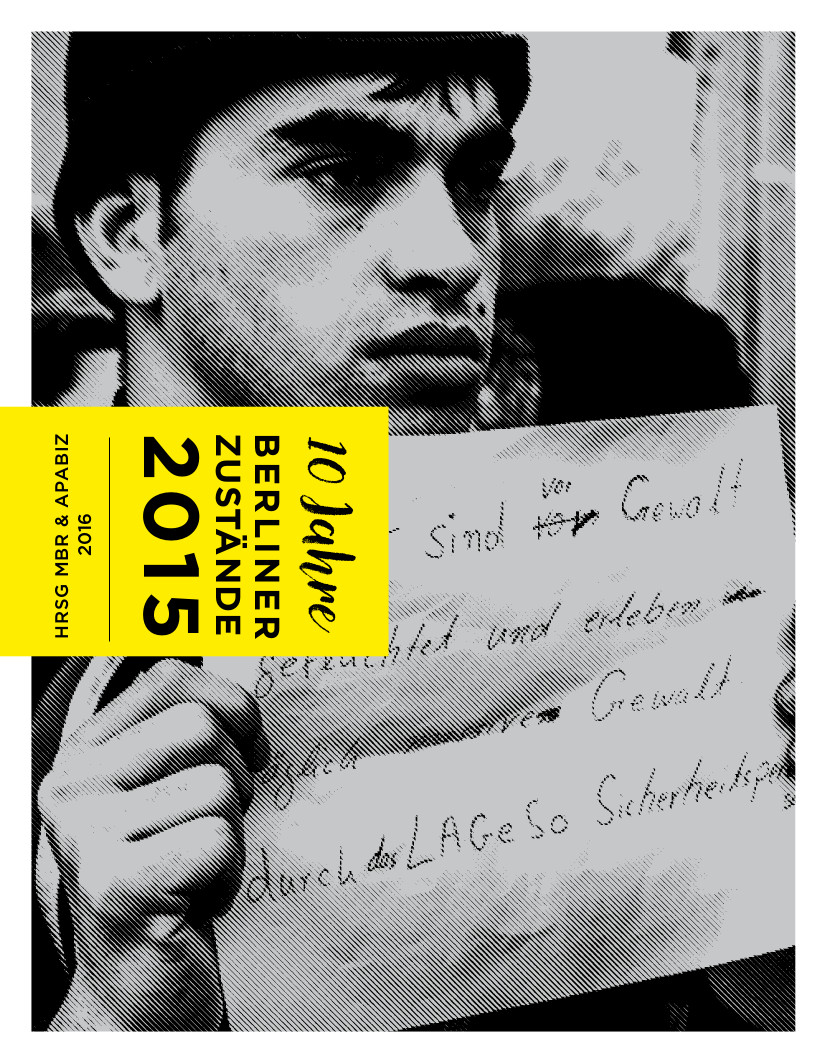
Als im Jahr 2007 der Schattenbericht, oder die „Berliner Zustände“ wie sie auch heißen, zum ersten Mal zu den Themen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus erschien, hätten Sie gedacht, dass es das Projekt noch gibt und der Bericht zum zehnten Mal erscheinen wird?
Ulli Jentsch: Nein. Das war am Anfang weder geplant noch vorauszusehen. Die Idee, den Schattenbericht zu schreiben, war 2006 aus existierenden Projekten entstanden – wie Chronologien oder Rückschauen zu erstellen. Außerdem haben wir die Probleme zahlenmäßig eingeordnet, um sie besser einschätzen zu können. Über die Jahre hat sich der Bericht dadurch verändert und ist sehr viel umfangreicher geworden.
Bianca Klose: Wenngleich wir den Bezug zu den „Deutschen Zuständen“ des Bielefelder Professors Wilhelm Heitmeyer gewählt haben, hatten wir nie vor, das genau so lange machen zu wollen wie Heitmeyer. Uns ging es um eine Zustandsbeschreibung jenseits von Statistiken und Berichten staatlicher Stellen. Wie es schon in der Einleitung des ersten Schattenberichts stand: Es geht um eine Interpretation, und um eine andere Definition dessen, was Rechtsextremismus ist. Um ein Beispiel zu nennen: Wir haben damals die Definition um das Phänomen des Antisemitismus erweitert. Zudem ging es uns darum, den Alltag aus der Perspektive von nicht-staatlichen Stellen zu beschreiben. Das gilt bis heute. Zwar sprechen die Zahlen der Strafverfolgungsbehörden, wenn es etwa um die Anschläge auf Flüchtlingsheime geht, eine deutliche Sprache. Aber trotzdem findet der Alltag der geflüchteten Menschen und der Menschen, die Flüchtlingen helfen, in der Wahrnehmung der staatlichen Stellen nicht statt.
War das vor zehn Jahren das Motiv, die Übergriffe quasi aus dem Schatten zu ziehen?
Sabine Seyb: Das ist es bis heute. Unsere Perspektive ist in erster Linie dadurch geprägt, was uns die Betroffenen und Bündnispartner erzählen. Von daher ging es von Anfang an nicht nur um Rechtsextremismus, sondern auch um Rassismus. 2006 hatte der Bericht noch eine andere Bedeutung, weil wir für die Ermittlungsbehörden eine Provokation darstellten: Dass wir mehr Übergriffe gezählt haben, dass wir anders gezählt haben und dass wir darauf bestanden haben, anders zu zählen, und zwar aus der Perspektive der Betroffenen, das hat im Laufe der Jahre etwas verändert. Wobei wir weiter streiten: Darum, wann ist eine Gewalttat eine rassistische Gewalttat, was wird getan, um das zu ermitteln. Die Qualität des Schattenberichts liegt darin, diese unterschiedlichen Perspektiven darzulegen. Uns verband von Anfang an das Grundverständnis, dass wir nicht in Kooperation mit staatlichen Stellen agieren, sondern ohne die Behörden.
Damals kursierte auch das Schlagwort vom „Alternativen Verfassungsschutzbericht“.
Ulli Jentsch: Das war und ist eine Beleidigung. Den Initiativen ging es nie darum, die Expertise der staatlichen Stellen zu verbessern. Im Gegenteil: Wir wollten aufzeigen, wie sich die Phänomene, über die auch der Staat redet, für uns und die betroffenen Gruppen darstellen. Wir haben einen „Shadow Report“ verfasst, wie es international genannt wird, der gegen den Bericht staatlicher Stellen geschrieben wird. Das leisten die „Berliner Zustände“ inzwischen. Im Kern bleibt aber die Definitionsmacht auf der Seite der staatlichen Stellen. Das zeigt sich in den Medien, bei denen die Akzeptanz der staatlichen Lesarten weiter enorm hoch ist. Es ist uns nicht gelungen, das grundlegend zu verändern. Durchzusetzen, dass es mindestens zwei Quellen in der Berichterstattung zu Phänomenen wie dem Rechtsextremismus geben muss. Stattdessen wird immer noch nachgeplappert, was aus den Behörden kommt.
Bianca Klose: Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz beschreiben die zehn Jahre „Berliner Zustände“ auch die Entwicklung unserer Projekte und die Anerkennung unserer Arbeit. Ich will mich nicht nur an staatlichen Stellen abarbeiten, sondern der erste Schattenbericht beschreibt Dinge, denen man Gehör verschaffen musste, weil sie sonst ungehört geblieben wären. Und an dieser Stelle hat sich wirklich was geändert, auch im Umgang der zivilgesellschaftlichen Projekte mit Verwaltung, Politik und Journalismus.
Das heißt der Anspruch, die Perspektiven zu verschieben, ist gelungen. Früh hat der Schattenbericht zum Beispiel Phänomene wie den antimuslimischen Rassismus beschrieben. Was waren die wichtigsten Veränderungen in der eigenen Analyse in den vergangenen Jahren?
Eike Sanders: Ein Erfolg der „Berliner Zustände“ war es, dass das Netzwerk an Projekten gewachsen ist, die sich beteiligen wollen. Es war auch gut, jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt zu legen. So konnten die Projekte jedes Jahr einen neuen Artikel mit einem bestimmten Fokus beisteuern. Viele Themen wurden von außen an uns herangetragen. Wir haben immer neue Projekte ins Boot geholt, die eigene Perspektiven auf den Rassismus haben. Entweder waren es neue Gruppen oder sie kamen aus Stadtteilen, für die sich niemand interessierte.
Sabine Seyb: Ich hätte vor zehn Jahren nicht gedacht, dass heute diese völlig enthemmten rassistischen Debatten geführt werden. Wir hatten die Neunziger Jahre doch hinter uns gelassen! Es ist auch erschütternd, dass so wenig rhetorische Gegenwehr aus intellektuellen Kreisen zu hören ist, um diese Diskurse zu beeinflussen. Aus dieser Perspektive ist die Bedeutung des Schattenberichts im Laufe der Jahre größer geworden.
Bianca Klose: Im ersten Schattenbericht wird die Situation in Pankow-Heinersdorf beschrieben. Dort gibt es das Thema „Bürgermob geht Schulter an Schulter mit organisierten Neonazis auf die Straße, um den Bau einer Moschee zu verhindern“. Wenn man sich heute anschaut, hätte ich nicht erwartet, dass sich das Gleiche wieder abspielt – nur mit dem Fokus auf die Unterbringung von Flüchtlingen. Die Situation auf der Straße ähnelt sich dermaßen. Hinzu kommt: Früher war der Fokus stark auf Rechtsextremismus ausgerichtet, nämlich der npd oder dem Umgang der Justiz mit rechtsextremen Gewalttätern. ReachOut hat dagegen immer stark den Fokus auf das Thema Rassismus gelegt. Dass sich das auch in vielen Arbeitsschwerpunkten beim Schattenbericht niederschlägt, war 2006 nicht absehbar. Wir arbeiten inzwischen viel mehr zum Thema Rassismus und insbesondere dem Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft als noch vor zehn Jahren.
Damit sind wir bei der aktuellen Lage. Es gibt immer mehr rechte Gewalt und Übergriffe und die bereits angesprochenen rassistischen Debatten. Wie wird sich das weiter entwickeln?
Ulli Jentsch: Wir haben es mit einer langfristigen Entwicklung zu tun, das zeigt ebenfalls das angesprochene Beispiel. Wenn man sich Bilder aus Pankow-Heinersdorf ansieht, kann man das wie eine Folie über heutige Pegida-Aufmärsche legen. Das ist vom Spektrum, von den Aussagen bis in die Details identisch – zum Teil sind es dieselben Personen. Diese politische Mobilisierung wird sich nicht abschwächen, aber weiter verändern. Was sich auch nach den ersten Wahlerfolgen der Alternative für Deutschland (AfD) gezeigt hat. Ein Teil der Leute, die auf die Straße gegangen sind, wollen diese parlamentarische Repräsentanz. Die Entwicklung könnte so weitergehen: Viele Rechte setzen weiter auf Straßenmobilisierung, andere auf die Parlamente und die Ablösung der Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Das ist nicht verrückt, sondern erklärtes Ziel dieses Spektrums. Auch bei weniger Mobilisierung sehen wir darüber hinaus, dass die Gewalt nicht zurückgeht. Dabei sind wir bereits auf einem unglaublich hohen Niveau, das wir gar nicht mehr skandalisiert kriegen.
Sabine Seyb: Dazu kommt, dass das Dunkelfeld der Gewalt in Bezug auf Geflüchtete hoch ist, weil diese Leute existentielle Nöte zu bewältigen haben, und sich deshalb nicht zu Wort melden, wenn sie aus rassistischen Gründen angegriffen werden. Was die Aufmärsche betrifft, kann ich mir vorstellen, dass das, was auf der Straße zu sehen ist, in nächster Zeit zurückgeht. Die Frage drängt sich doch auf: Wozu braucht es eine AfD, wenn viele ihrer Forderungen im vorauseilenden Gehorsam umgesetzt werden? Es läuft wie in den Neunzigern: Reflexartig werden Gesetze verschärft, weil der Mob auf der Straße das gefordert hat.
Welche Auswirkungen haben diese Tendenzen auf die Broschüre?
Bianca Klose: Das bleibt abzuwarten. Der Schattenbericht hat in den letzten zehn Jahren den Projekten sicherlich zwar mehr Gehör verschafft. Aber der Rechtsruck wiegt schwer und es ist krass, mit welcher Geschwindigkeit Errungenschaften wie die Aufhebung der Residenzpflicht für Flüchtlinge wieder zurückgenommen wurden, ohne dass es der Zivilgesellschaft oder Initiativen gelungen ist, dem etwas entgegenzusetzen. Deshalb müssen wir in den nächsten Jahren wieder stärker auf den Schattenbericht setzen, um Zustände zu beschreiben, die sonst kaum Gehör finden. Dabei darf nicht verkannt werden, dass viele Initiativen weder Zeit noch Ressourcen haben, die Artikel zu schreiben.
Paula Tell: Um den Willkommens-Initiativen für Geflüchtete die Arbeit zu erleichtern, haben wir für den diesjährigen Schattenbericht angeboten, mit einem Aufnahmegerät vorbeizukommen. In der Redaktion haben wir all diesen Initiativen die gleichen Fragen gestellt, um den Zugang zu erleichtern. Es war uns sehr wichtig, dass diese Gruppen vorkommen, die sich so auf vielen Ebenen abmühen. Das muss einfach auch im Schattenbericht thematisiert werden. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die überhaupt kein Geld für ihre Arbeit kriegen, am Ende nicht in der Broschüre vorkommen.
Sabine Seyb: Im Sommer 2015 wurden diese Initiativen, die Geflüchtete unterstützen, noch gehypt, beklatscht und mit Preisen überschüttet. Dann reichte ein Fehltritt von einem aus der Initiative Moabit Hilft, um das Thema so zu deckeln, dass kein Mensch mehr darüber redet – weder über deren großartige Arbeit noch über die Art und Weise, wie sie Bedrohungen ausgesetzt sind.
Früher galt Berlin als so etwas wie die Insel der Glücksseeligen: Es gibt hier viele Initiativen, und die Rechten schienen zurückgedrängt worden zu sein. Daran hat sich ebenfalls einiges geändert.
Ulli Jentsch: Ein Adressat des Schattenberichts war immer die Berliner Politik. Nicht nur im Sinne, jetzt helft uns mehr, sondern es ging auch darum, auf die Diskrepanz zwischen Sonntagsreden und der realen materiellen Situation der Projekte aufmerksam zu machen, die gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus kämpfen. Das betrifft eine grundsätzliche Kritik: Am Beispiel der Unterstützung für die Flüchtlinge ist deutlich erkennbar, dass es dem Staat um Outsourcing geht. Dabei könnte er das ganz anders lösen. Genauso gab es immer einen Widerspruch zwischen den politischen Aussagen etwa eines Innensenators und zwischen dem, was die Polizei auf der Straße machte. Das ist ein sich über die Jahre durchziehendes Spannungsfeld. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, wie schwierig es ist, Kritik offen auszusprechen. Es gab und gibt Themen, über die keiner sprechen oder schreiben will.
Was waren das für Themen?
Ulli Jentsch: Zum Beispiel ging es um die Frage, wie deutlich man Kritik an der Polizeistrategie und der Vorgehensweise gegen die neonazistische Rechte äußern kann. Die Auseinandersetzung um den Nationalen Widerstand Berlin (NW-Berlin) etwa haben wir jahrelang führen müssen. Da so eine offene gewalttätige und neonazistische Organisation so lange aktiv sein konnte, zeigt, dass nicht alles gut funktioniert. Viele Projekte wollen die Politik immer wieder auf Missstände aufmerksam machen und sie zum Handeln zwingen.
Wie waren denn über die Jahre die Reaktionen aus der Politik auf den Schattenbericht? Gab es Erfolge und Misserfolge?
Bianca Klose: Zu NW-Berlin hat die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin drei Jahre hintereinander Artikel geschrieben. Solange haben wir die Politik und die Strafverfolgungsbehörden vor uns hergetrieben. Zwar waren wir irgendwann erfolgreich, aber es war aufreibend, wir waren erschöpft und wir mussten die Ermittlungsarbeit der Polizei machen: Mosaiksteinchen zusammenfügen, und das Gesamtbild am Ende der Staatsanwaltschaft in Form eines Dossiers vorlegen.
Sabine Seyb: Bei vielen Themen ist das, was im Schattenbericht erscheint, nur ein Ausdruck einer Perspektive. Deshalb kann man gar nicht sagen, wie reagiert die Politik auf einen Schattenbericht-Artikel, sondern es geht vielmehr darum, wie die Einbindung in die praktische Arbeit klappt. Was wir aus den anderen Opferberatungsstellen mitbekommen, ist, dass wir in Berlin – bei allen Einschränkungen – in einer luxuriösen Situation sind, wenn es darum geht, Bündnispartner zu gewinnen. Ich habe aber den Eindruck, dass auch in der Hauptstadt die kleinen Projekte, die keine staatlichen Gelder erhalten, es immer schwerer haben. Da ist es eine Stärke des Schattenberichtes, diejenigen zu Wort kommen zu lassen.
Das beschreibt den PlattformCharakter, den der Schattenbericht angenommen hat, wie soll er sich in Zukunft weiterentwickeln?
Sabine Hammer: Es gibt immer wieder Überlegungen, den Schattenbericht zu verändern und auch online aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Anderseits eignet sich die Papierform gut für einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Ganz einfach, weil man in einem kompakten Heft sieht, was die Initiativen im vergangenen Jahr geleistet haben.

